Der
obligate Morgenspaziergang des
Gelterkinder Kunstmalers und Archäologen
Fritz Pümpin (1901-1972) war klar
vorgezeichnet: Es war ein Rundgang um das
Dorfzentrum, entlang des auf der
Südseite der Ergolz verlaufenden Teils
des ehemaligen Etters.
DER BEGRIFF
"ETTER"
Etter? Ein Familienname?
Selbstverständlich. Vorfahren der Etters
wohnten mit Bestimmtheit einmal an einem
Etter oder in dessen Nähe, womit sie zu
ihrem Namen gekommen sein dürften.
Vielleicht auf gleichem Weg wie die
Egger, deren Vorfahren auf einer Egg
wohnten. Was nun aber ein Etter ist, wird
noch näher zu erklären sein.
Das
Schweizerische
Idiotikon von 1832 erklärt
den Begriff "Etter" (auch
"Atter") als "Einfassung
eines gewissen Bezirkes und der innerhalb
desselben gelegenen Grundstücke".
Im
Grundsatz handelt es sich um ein
Grenzzeichen, eine Linie in der
Landschaft, die als solche keine Substanz
aufweist, aber in der Regel als Lebhag
(Hecke) oder geflochtener Zaun sichtbar
ist.
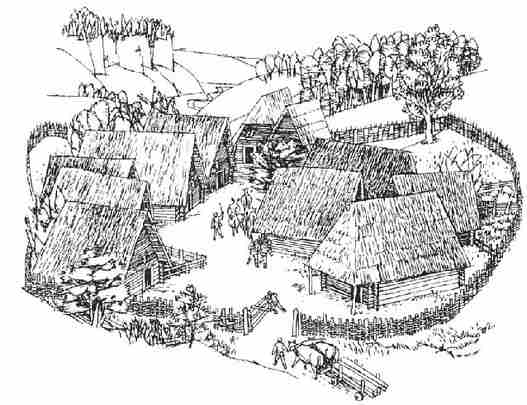
Die Zeichnung eines
mittelalterlichen Dorfes zeigt uns, wie
es auch in Gelterkinden ausgesehen haben
könnte: Ein geflochtener Zaun, (der
"Etter" ) umgibt den Wohn- und
Wirtschaftsbereich. Gatter dienen als
Zugang zu den ausserhalb gelegenen
Arealen.
(Aus Arnold Jäggi: Helvetier, Römer,
Alamannen. 1968)
DER ETTER ALS TEIL
DES HOFES UND DER SIEDLUNG ...
Genau wie Städte sind Dörfer das
Resultat eines über eine längere Zeit
dauernden Entwicklungsprozesses. In
dessen Verlauf wurden umfriedete
Einzelhöfe und Hofgruppen zu Weilern und
Dörfern und damit zu speziellen
wirtschaftlichen, sozialen und
rechtlichen Gebilden. Als Hauptphase für
diese Entwicklung gilt die Zeit des Hoch-
und Spätmittelalters. Im ausgehenden
Mittelalter gliederten sich Dörfer in
der Regel in einen Dorfkern (dem Wohn-
und Wirtschaftsbereich mit umgebendem
Gartenland), in eine Ackerflur sowie in
Allmend- und Weidegebiete. Der Etter bot
für den umgebenden Bereich einen Schutz
gegen Mensch und Tier. Gatter dienten als
Durchgänge in die ausserhalb gelegenen
Wirtschaftsbereiche.
... BEGRENZT EINEN
FRIEDENS UND RECHTSBEREICH
Analog dem durch Mauern begrenzten
städtischen Siedlungsraum ist der vom
Etter umgebene Dorfbereich - "Innert
Etters" - ein geschützter Rechts-
und Friedensbereich: Die darin
eingeschlossene Infrastruktur (Wege,
Brunnen, Versammlungsort, Festplatz
etc.), mit Ausnahme der Hofstätten und
Behausungen, stand in Gemeinnutzung der
Dorfbewohner. Nur durch klar definierte
Zugänge (Wege und Gatter) konnte das
Dorf betreten werden. Zum Schutz dieses
inneren Dorfbereichs gesellte sich schon
früh, hervorgehend aus dem für die
Wohnstatt anerkannten Hausfrieden, eine
Art Asylrecht, wie wir es vom Kirchenasyl
kennen. Innerhalb des Etters konnten
Verfolgte Schutz erwarten oder aus diesem
Bereich verbannt werden. Die besondere
Stellung des Dorfraumes manifestierte
sich anhand von eigenen Gerichten, den
sogenannten Ettergerichten die meist
unter einer Dorflinde abgehalten wurden.
Die Gerichtsbarkeit "Ussert
Etters" oblag in der Regel dem
regierenden Landvogt.
Der
Etter begrenzte auch den Raum, in welchem
die Erstellung von Häusern möglich war.
In
der Regel ausserhalb des Dorfes gelegene
Mühlen, Sägen, Ölen, etc. waren
ebenfalls mit einem Etter umgeben (z.B.
Mühlenetter).
DER GELTERKINDER
DORFETTER
1947 hat Fritz Pümpin bei Grabarbeiten
im Gebiet Bützenen eine künstliche
Aufschüttung beobachtet. Zehn Jahre
später stellte er den selben Befund -
einen Wall mit vorgelagertem Graben -
nochmals fest. Für den Archäologen
stand fest, dass es sich bei diesen
Funden um einen konkreten Hinweis auf den
ehemaligen Etter handelte. Eine Datierung
konnte allerdings nicht vorgenommen
werden.
Tatsächlich
lässt sich im Plan von Georg Friedrich
Meyer (1680) im Bereich "In der
bützenen" sowie weiteren Teilen des
Dorfes der Etter erahnen.
Die heute noch begehbaren Teile sind im
Dorf als unüberbaute Areale erhalten
geblieben: Durchgang Allmendmarkt, ein
Teil des Parkwäglis, Durchgang zwischen
den Bauten der ehemaligen Gerberei,
Sirachewägli, Gartenweg, Gansacherweg,
Chillegässli, unterer Teil des
Zehntenwäglis, Obere Mühle. Die Kirche
liegt ausserhalb des Dorfetters und ist
durch eine Mauer geschützt.
Der
nördlich der Ergolzstrasse gelegene Teil
wurde, falls er nicht mit der Ergolz
zusammenfiel, beim Bau der
Hauenstein-Basislinie entfernt oder
überdeckt. Die Tatsache hingegen, dass
die erwähnten Wegabschnitte im Dorf als
Parzellen ausgeschieden (oder dafür
Gehrechte im Grundbuch eingetragen) sind,
ermöglichen es, dass wir den ehemaligen
Dorfetter zum Teil noch abschreiten
können.
|